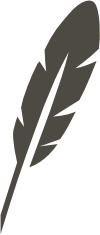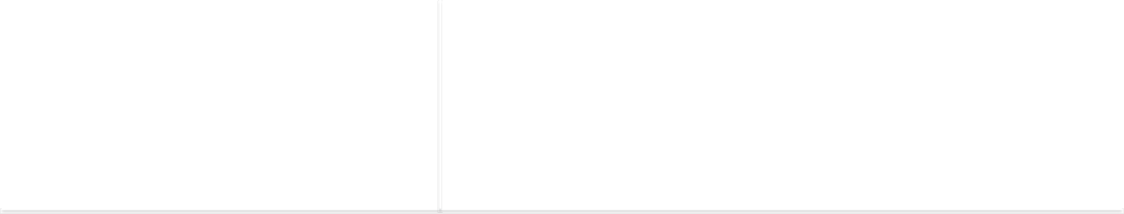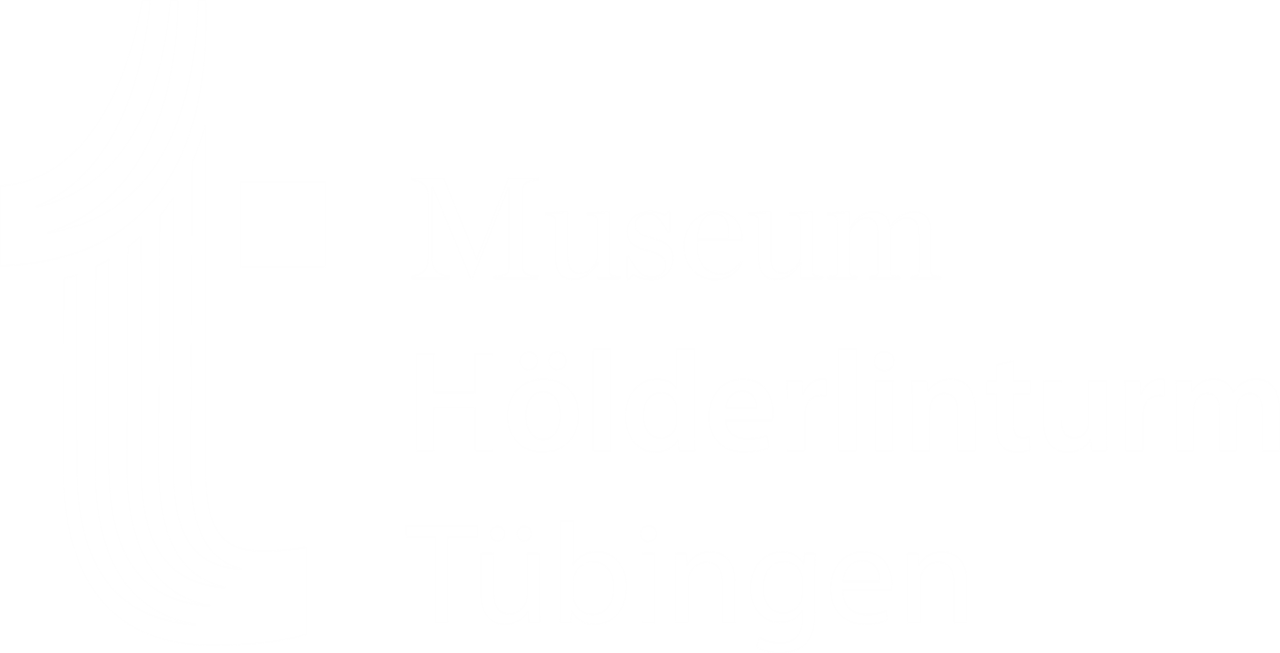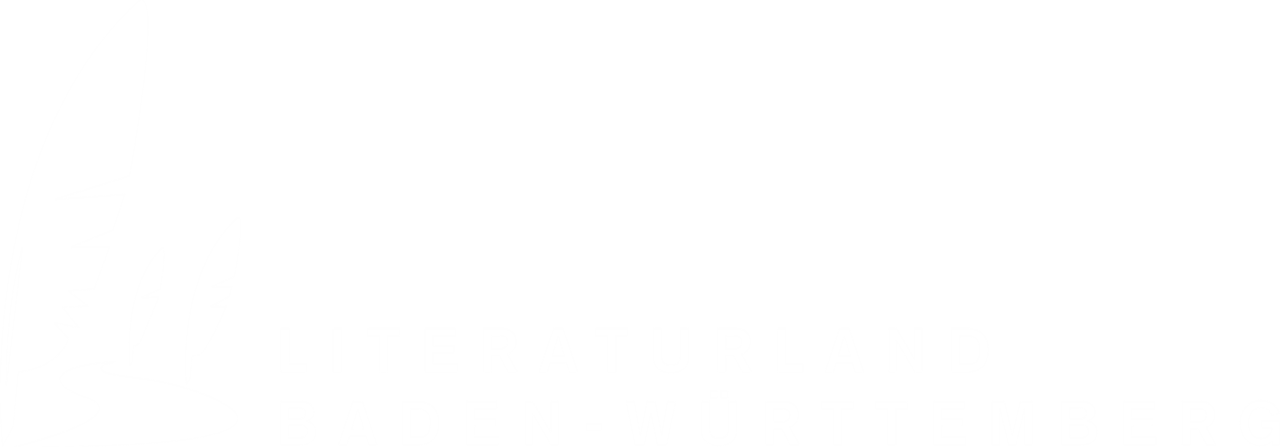Aktuelles | 31.03.2025
Turmvortrag: Stefan Zweig und Friedrich Hölderlin: eine literarische Begegnung
Der österreichische Weltautor Stefan Zweig setzte sich in den 1920er Jahren intensiv mit Figur und Werk Friedrich Hölderlins auseinander. Aus dieser Beschäftigung entstanden vier Texte, die bisher kaum wissenschaftliche Beachtung fanden: der Artikel Hölderlin der romantische Mensch (1923), der Hölderlin-Essay aus der Trilogie Der Kampf mit dem Dämon (1925), eine Rezension von Wilhelm Michels Friedrich Hölderlin (1926) und ein bislang unveröffentlichter Vortrag Goethe und Hölderlin (1926) aus dem Nachlass.
Der Turmvortrag nimmt diese Hölderlin-Schriften zum Ausgangspunkt, um Zweigs Hölderlin-Bild und dessen Relevanz für die ästhetische und literaturhistorische Reflexion der Zeit zu diskutieren. Die drei Vortragenden – Elena Polledri, Arturo Larcati und Erika Capovilla – beleuchten diese literarische Begegnung aus unterschiedlichen, sich ergänzenden Perspektiven.
Elena Polledri, Professorin für Deutsche Literatur an der Universität Udine und Vorstandsmitglied der Hölderlin-Gesellschaft, stellt Zweig als Hölderlin-Leser vor, rekonstruiert anhand seiner Lektüren die Motive und Interpretationsansätze, die seine Annäherung an Hölderlin kennzeichneten und situiert sie im Rezeptionskontext der Epoche.
Arturo Larcati, Professor für Deutsche Literatur an der Universität Verona und ehemaliger Leiter des Stefan Zweig Zentrums an der Universität Salzburg (2019–2023), geht insbesondere auf die Frage ein, wie Zweig Hölderlin in sein eigenes Denken und Schreiben integrierte, mit besonderem Augenmerk auf den Topos des Dämonischen in seiner Dichtertheorie.
Erika Capovilla, als Postdoktorandin für Deutsche Literatur an der Universität Udine nach ihrer Promotion über Zweigs Humanismus an der Universitäten Udine und Salzburg tätig, widmet sich Zweigs Hölderlin-Autografen und bestimmt Zweigs Rolle als Autografensammler im Netzwerk der ‚Hölderlin-Renaissance‘; besonderes Augenmerk fällt dabei auf Zweigs kunsttheoretische Überlegungen zum ‚Geheimnis des künstlerischen Schaffens‘.
Der Eintritt ist frei
Weitere Artikel:
- Turmvortrag: Stefan Zweig und Friedrich Hölderlin: eine literarische Begegnung
- Ausstellungseröffnung Peter Brandes
- Rekord-Besucherzahlen im Turm!