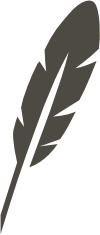Informationen unserer Mitglieder | 14.06.2024
Mythopoesie der Liebe - Hölderlins "An die Madonna"
Das von der Forschung vernachlässigte und kontrovers diskutierte späte Gedicht Hölderlins <An die Madonna> ist eine elegische Hymne, in der Hölderlin seiner Dichtung eine poetologische Neuorientierung gibt, die dem Geist der Zeit zwischen 1800 und 1805/06 entspricht. Die Studie weist nach, dass Hölderlin dem Lyrischen die neue Aufgabe zuweist, im Bild der Madonna als neue „Mythe“ die Ideale der Französischen Revolution mit der geschichtlichen Realität zu „versöhnen“ gegen eine sich immer regressiver verhaltende nachrevolutionäre Gesellschaft.
Hölderlin verlässt den frühromantischen Diskurs und eröffnet seiner Dichtung einen grundlegend neuen Horizont. Ohne Christus, den „Sohn“, vermittelt die Madonna als zentrale „Mythe“ die Liebe als wesentliche Botschaft der „alten“ an die „neue“ Religion, die jetzt eine poetische ist. Das Gedicht kann deshalb als eine „Poetik der Liebe“ bezeichnet werden.
In Abkehr von antiken Kunstregeln und dank der Hinwendung zum „Eigenen“ in Bildlichkeit, Form und Sprache wäre der Weg offen gewesen für eine populärere und damit wirksamere Lyrik. Sie sollte sich einfügen in einen auf Langfristigkeit gestellten Bildungsprozess, dessen Ziel es ist, die in der „terreur“ verratenen Ideale der Revolution im „Glauben“, in der „Liebe“ und in der „Hoffnung“ in gesellschaftliche Realität zu überführen.
Weitere Artikel:
- Die Jahreszeiten - Künstlerbuch von André Butzer
- Mythopoesie der Liebe - Hölderlins "An die Madonna"
- Hubertus Danner - Pindars Flucht aus Klopstocks Chaise